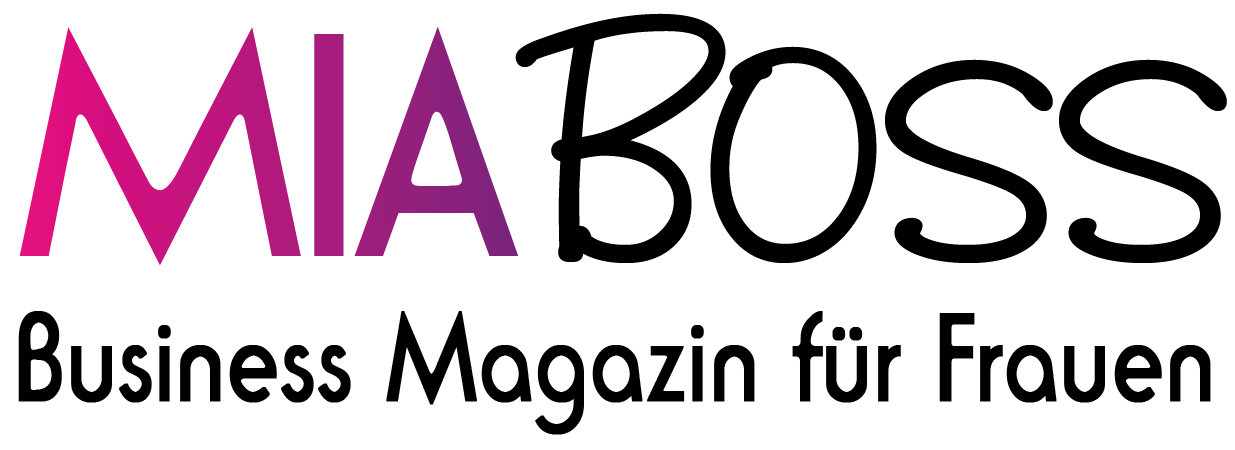Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung sind in Deutschland gleich viele Frauen im Westen wie im Osten erwerbstätig. Das mag einerseits ein historischer Moment sein, andererseits flammt hier jedoch eine alte Debatte neuerlich auf. Denn wie steht es wirklich um die wirtschaftliche Gleichstellung? Während die Beschäftigungszahlen steigen, bleibt der Lohnunterschied bestehen. Auch beim Gründen von Unternehmen hinken Frauen hinterher. Das liegt vor allem an strukturellen Barrieren, Rollenbildern und fehlender Unterstützung, die das Potenzial weiblicher Fach- und Führungskräfte noch immer ausbremsen.
Frauen auf dem Arbeitsmarkt: Ost und West ziehen gleich

Seit 1990 liegt die Erwerbstätigenquote von Frauen in Westdeutschland gleichauf mit jener in den ostdeutschen Bundesländern. Das Statistische Bundesamt hat mitgeteilt, derzeit arbeiten rund 74 Prozent aller Frauen zwischen 15 und 65 Jahren, was ein markanter Anstieg gegenüber den 57 Prozent zur Zeit der Wiedervereinigung ist. Spitzenreiter sind die Bundesländer Bayern und Sachsen, wo rund 77 Prozent der Frauen einen Job haben. Am unteren Ende der Skala steht Bremen mit etwa 67 Prozent.
Damit hat man ein zentrales Ziel der Gleichstellungspolitik erreicht: Die jahrzehntelange Kluft zwischen Ost und West hat sich fast zu 100 Prozent geschlossen. In den 1990er Jahren galt die hohe Erwerbsbeteiligung ostdeutscher Frauen noch als ein Relikt der DDR-Struktur, während im Westen hingegen lange das traditionelle Rollenmodell dominierte. Heutzutage ist es in ganz Deutschland normal, dass die Frau einer Arbeit nachgeht.
Dennoch zeigt sich ein doch sehr differenzierteres Bild, wenn man auf Einkommen und Arbeitsbedingungen blickt. Auch wenn Frauen in Ostdeutschland im Durchschnitt nur fünf Prozent weniger als Männer verdienen, beträgt der sogenannte Gender Pay-Gap jedoch weiterhin rund 16 Prozent im Westen. Gleichzeitig liegen die Bruttolöhne im Osten nach wie vor niedriger – sie haben sich seit der Wiedervereinigung zwar vervierfacht, sind aber mit knapp 4.000 Euro pro Monat aber deutlich hinter dem westdeutschen Schnitt von rund 4.800 Euro zurück.
Regionale Unterschiede und demografische Herausforderungen
Auch wenn die Gleichstellung bei der Erwerbstätigkeit erreicht scheint, sind die wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen in Ost und West noch immer sehr unterschiedlich. In Thüringen oder Sachsen-Anhalt ist die Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahrzehnten rasant gewachsen. In Thüringen etwa um 163 Prozent seit dem Jahr 1990. Doch dieser Aufschwung wird durch die demografischen Entwicklungen geschmälert. Denn immer mehr junge Menschen, die eine gute Ausbildung haben, verlassen die ostdeutsche Region und suchen im Westen nach Jobs oder blicken ins Ausland, wenn es um bessere Karrierechancen geht.
Damit schrumpft natürlich die Bevölkerung im Osten erheblich, während der Westen schneller wächst. Der Mangel an Fachkräften bremst heute auch vielerorts den weiteren Aufschwung. Besonders Frauen spielen hier eine nicht außer Acht zu lassende Rolle: Frauen bilden das Rückgrat vieler mittelständischer Unternehmen, stoßen jedoch oft an unsichtbare Grenzen, wenn es um Führungspositionen oder Unternehmensgründungen geht. Denn obwohl es mehr Frauen als je zuvor gibt, die erwerbstätig sind, zeigt sich ein ganz anderes Phänomen: Sie gründen seltener eigene Unternehmen.
Sieht man sich beispielsweise den „Female Founders Report 2025“ des Start-up-Verbands in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung an, so liegt der Anteil weiblicher Gründer in Deutschland bei gerade einmal 19 Prozent. Das entspricht sogar einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Dabei wäre gerade diese Gruppe der entscheidende Faktor für die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft.
Warum Deutschland mehr Gründerinnen braucht
Laut der Studienautorin Verena Pausder, die Vorstandsvorsitzende des Start-up-Verbands, scheitert das weibliche Unternehmertum weniger an dem mangelnden Interesse, sondern an ungleichen Bedingungen. Frauen hätten nämlich noch immer schlechtere Zugänge zu Kapital, zu Netzwerken und zu Mentoringprogrammen. Die Zahl der Venture Capital-Investitionen in Start-ups mit Gründerinnen habe sich zwar seit dem Jahr 2017 fast verdoppelt, doch fließen noch immer über 90 Prozent des Risikokapitals in Männerteams. Man kann also davon ausgehen, wenn ein Start-up im Bereich Glücksspiel gegründet und dann ein Online Casino diesen Monat neu gestartet wird, dann wird im Hintergrund wohl ein Team von Männern maßgebend beteiligt sein. Aber auch abseits dieser Branche haben Männer das Kommando, wenn man sich die Start-up Gründer anhand ihres Geschlechts ansieht.
Hinzu kommen auch gesellschaftliche Faktoren: Laut Umfragen betrachten rund 60 Prozent der Studentinnen Arbeitsplatzsicherheit als vorrangig, während nur rund 21 Prozent ernsthaft in Erwägung ziehen, ein eigenes Unternehmen gründen zu wollen. Bei männlichen Studierenden ist dieser Anteil doppelt so hoch. Schon in der Ausbildung prägen also Sicherheitsdenken und Rollenbilder das Karriereverständnis der heutigen jungen Frauen.
Dabei wäre gerade die Förderung von weiblichen Gründern der Schlüsselfaktor für die Innovation. Die Bertelsmann Stiftung bezeichnet Frauenförderung im Start-up-Sektor als „strategisches Innovationsmanagement“. Würde es in Gründerteams mehr Diversität geben, könnte das nicht nur die wirtschaftliche Dynamik erhöhen, es würde auch die Qualität von Geschäftsmodellen verbessern. Die Daten belegen, dass Mixed-Teams im Schnitt höhere Renditen erzielen und des Weiteren auch wesentlich resilienter in Krisenphasen sind.
Strukturelle Hürden und kulturelle Barrieren

Ein zentrales Problem stellt auch die Finanzierung dar. Denn laut einer Studie der Unternehmensberatung Baulig Consulting empfinden 48 Prozent der Gründerinnen den Zugang zu Kapital als „hohe Hürde“. Bei den Männern sind es rund 10 Prozent weniger. Viele Investoren setzen unbewusst auf stereotype Risikobewertungen und unterschätzen das Potenzial der weiblichen Unternehmer.
Darüber hinaus bleibt auch die Vereinbarkeit von Familie und Unternehmertum ein strukturelles Hindernis. 8 von 10 Frauen nennen sie die größte Herausforderung. Auch Männer sehen hier Nachholbedarf, jedoch mit geringerer Dringlichkeit. Solange die Betreuungsangebote, Arbeitszeiten und gesellschaftliche Erwartungen nicht besser aufeinander abgestimmt sind, bleibt das Unternehmertum für viele Frauen eine sehr schwierige Entscheidung, die oft dazu führt, dass man sich bewusst gegen ein klassisches Familienleben entscheidet.
Das Start-up-Ökosystem selbst gilt zudem als nicht gerade einladend. Nur die Hälfte der männlichen Gründer erkennt laut „Female Founders Report“ die Geschlechterungleichheit als Problem an. In Teams mit mindestens einer Gründerin steigt dieses Bewusstsein auf 64 Prozent. Das heißt, es ist durchaus wichtig, dass Diversität sichtbar wird.